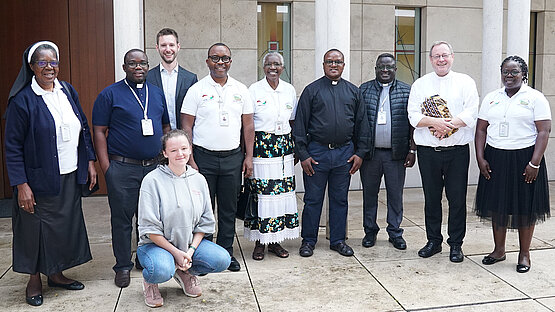Sich zurücknehmen, bewusster leben, den eigenen Konsum reduzieren – dazu entscheiden sich viele Menschen in der vorösterlichen Fastenzeit. Seit einiger Zeit liegt das Plastikfasten im Trend. Wir stellen vor, worum es dabei geht und warum man es trotz, oder gerade in der Corona-Krise unterstützen sollte – auch über die Fastenzeit hinaus.
Jährlich werden knapp 400 Millionen Tonnen Plastik hergestellt, von denen laut BUND Europa allein ein Viertel verbraucht. Deutschland ist mit 14 Millionen Tonnen Plastikverbrauch im Jahr Vorreiter. Nur 12 Prozent davon stammt aus recyceltem Plastik. 88 % des verbrauchten Plastiks stammt aus neu produziertem Kunststoff.
Plastikfasten in Zeiten von Corona
In Zeiten der Corona-Krise müssen wir uns beschränken – in unserem Konsumverhalten, unseren Freizeitaktivitäten, unseren sozialen Kontakten. Die Supermärkte sind überfüllt und leergekauft, der Kontakt zu anderen Personen wird aufs Notwendigste minimiert.
Warum nicht beim nächsten Hofladen oder Wochenmarkt Obst und Gemüse einkaufen und im mitgebrachten Korb oder Stoffbeutel transportieren? Auch manche (Bio-) Supermärkte und unverpackt-Läden bieten plastikfreie Produkte an.
Der BUND zeigt auf folgender Karte plastikfreie Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung:
https://www.bund.net/themen/chemie/achtung-plastik/plastikfasten/plastikfrei-einkaufen/
Handmade – nicht nur plastikfrei, sondern hilft auch gegen die Corona-Langeweile:
Produkte wie Seifen oder Putzmittel können aus Haushaltsmitteln selbst hergestellt werden. Tipps dazu auf BUND und unter zahlreichen Blogs.
Den eigenen Produktbestand in Küche, Bad und Abstellraum auf Mikroplastik überprüfen – mit dem BUND-Einkaufsratgeber
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/bund-einkaufsratgeber-mikroplastik/
Erfahrungsbericht zum Plastikfasten unter:
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/20265.html
Verantwortung übernehmen durch plastikfreien Konsum und Anti-Wegwerf-Mentalität
Als Verbraucher haben wir durch unsere Kaufkraft die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen – vor allem angesichts des großen Anteils von Verpackungen am gesamten Plastikvolumen. Der Verzicht auf Einwegverpackungen aus Plastik wie Lebensmittelverpackungen, Plastiktüten, Plastikgeschirr- und besteck, sind Beispiele zur Bekämpfung von Rohstoffverschwendung und zur Einübung eines klimafreundlichen Lebensstils. Die reine Vermeidung von Plastik kann allerdings nicht die Lösung sein. Auch alternative Materialien aus Stoff, Papier oder Metall können nur positive Effekte erzielen, wenn sie möglichst lange benutzt werden.
Umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft
Es ist notwendig, eine global umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft zu etablieren, welche die Folgen des Plastikkonsums nicht an Länder mit geringerer Wirtschaftskraft auslagert. Diese besitzen oft nicht die Kapazitäten, um ein tragfähiges nachhaltiges Kreislaufsystem aufzubauen.
Unternehmen sind gefordert, alternative Verpackungsmethoden und umweltschonende Produktlinien zu entwickeln. Seitens der Politik müssen Anreize für eine solche Wende gesetzt werden. Die Verbraucher sind in der Lage, Druck auf diese Bereiche auszuüben, indem sie ihre Kaufkraft auf nachhaltige Waren fokussieren und auch auf Konsum verzichten. Ein Kulturwandel von der Wegwerfgesellschaft hin zur nachhaltigen Gesellschaft bedarf der Anstrengung eines jeden Einzelnen.
Die Fakten – Plastik und Umweltbelastung
Ein Großteil des hergestellten Kunststoffs – mindestens ein Viertel – wird für Verpackungen verwendet. Auch der Bau- und Automobilsektor verbrauchen zusammen ein Drittel der Plastikmengen. Der Plastikkonsum hat in den letzten 30 Jahren rapide zugenommen und bedroht auf vielfältige Weise unser Klima und unsere Umwelt. Für die Produktion eines Kilogramms Plastik wird die doppelte Menge Öl benötigt. 52 % des weltweiten Plastikmülls werden in Müllverbrennungsanlagen verbrannt, wodurch der CO2-Ausstoß zunimmt. Rund 6 Millionen Tonnen Plastik landen sofort auf dem Müll. Nur 39 % des Plastikmülls werden recycelt. Die Tatsache, dass der Plastikmüll für eine bessere Ökobilanz ins Ausland exportiert wird verschiebt das Problem, löst es jedoch nicht. Denn dort wird er unter schlechteren Bedingungen weiterverarbeitet oder verbrannt.